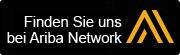Kommunikationstrend September: Der Shitstorm als Kommunikationsstil
Die FDP hat ein Kommunikationsproblem. Gute Inhalte alleine reichen nicht mehr, um den Bürger von den eigenen Positionen zu überzeugen. Die Verpackung muss mindestens genauso attraktiv sein wie der Inhalt. Wer sich am besten zu vermarkten weiß, hat den größten Erfolg. Das hat die FDP im Wahlkampf 2017 geschafft. Sie hat sich nicht nur aus der Versenkung gerettet, sondern sich auch ein neues Image verpasst, man hörte ihr wieder zu. Dieser Trend war erfolgreich, immerhin bescherte er uns 10,7% der Stimmen zur Bundestagswahl. Leider konnten wir an diesen Erfolg nicht anknüpfen. Eine neue Strategie muss her, da sind sich die meisten einig. Innerhalb der FDP werden nun vereinzelt Stimmen laut, man müsse mehr Provokation wagen. Man solle sich nicht von den Medien abhängig machen, sondern die Medien von uns. Oberflächlich betrachtet klingt dieser Ansatz sehr attraktiv, denn als Opposition sind wir traditionellerweise auf die Aufmerksamkeit der Medien angewiesen. Doch wie ließe sich die Abhängigkeit von den Medien ändern?Besonders auf Twitter schwören viele Libertäre und Anarchokapitalisten auf das Potential eines Shitstorms. Dieser Idee scheinen auch einige klassische Liberale nicht abgeneigt zu sein. Shitstorms werden als visionärer Kommunikationsstil gepriesen. Erst provozieren, dann im entfachten Shitstorm eine sachliche Erklärung liefern. Doch was ist ein Shitstorm eigentlich genau? Der Duden definiert einen Shitstorm als „Sturm der Entrüstung, in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht“.
Es handelt sich also vorwiegend um eine negative Reaktion auf eine (provokante) Aktion. Das scheint auf den ersten Blick keine erstrebenswerte Ausgangssituation für eine demokratische Partei zu sein. Vorsätzlich einen Sturm der Entrüstung hervorrufen, um dann in einer sachlichen Debatte unsere Positionen zu begründen? Das klingt nicht nur widersprüchlich, das ist es auch.
Eine provokative Rhetorik beinhaltet eine Übertreibung der eigentlichen Position. Die Message ist meist kurz und prägnant, wie im allseits bekannten Beispiel „Steuern sind Raub.“ Bevor wir nun aber in eine tiefe juristische Diskussion abtauchen, warum der Begriff „Raub“ für die Abgabe von Steuern von vornherein juristisch inkorrekt ist, sich damit also eine sachliche Debatte zu dem Thema erübrigt, konzentrieren wir uns auf die weitere inhaltliche Bedeutung des Satzes. „Der Staat beraubt uns unseres Geldes.“ Es geht uns also eigentlich darum, Kritik an der zu hohen Steuerlast zu üben – nur ohne Inhalte. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Hört uns daraufhin überhaupt noch jemand zu, wenn wir nach dieser (inhaltlich mangelhaften) Plattitüde, argumentativ über unsere tatsächlichen Positionen zu Steuersenkungen reden möchten?
Um diese Frage beantworten zu können, sollten wir einen weiteren Blick auf die Parteienlandschaft werfen. Es gibt schließlich Parteien, die die Aufmerksamkeitsstrategie des Provozierens perfektioniert haben. Dazu zählen vor allem populistische Parteien, die sich in ganz Europa breit machen. Wir konzentrieren uns auf die populistische Partei Deutschlands, die AfD. Die Politiker der AfD erregen mit extremen Aussagen und Provokationen immer wieder Aufmerksamkeit. Danach wird relativiert und dementiert. Tatsächlich gehören diese Tabubrüche zu ihrer Wahlkampfstrategie. Erst der große Aufschrei, der für besonders viel Aufmerksamkeit sorgt, anschließend wird schnell relativiert. Der Erfolg: Die Aufmerksamkeit, ist vorprogrammiert. Medien berichten über Aussagen von Alexander Gauland, der Boateng nicht als Nachbarn haben wolle und Beatrix von Storch, die Frauen und Kindern den Zutritt ins Land mit Waffengewalt verwehren möchte. Sobald der gewünschte mediale Aufschrei erzielt wurde, wird dementiert und verharmlost. Eigentlich meine man ja etwas völlig anderes.
Doch was hat die AfD davon? Um auf die oben gestellte Frage zurückzukommen: Ja, man wird gehört. Aber was wird gehört: der negative, spalterische Ton, der polarisiert und somit einen weiteren Keil zwischen die treibt, die einen ohnehin gut finden, und die, die einen bereits kritisch beäugen. Wollen wir jedoch mehr Menschen für unseren Ideen begeistern, sollten wir bestenfalls eine breite Gruppe ansprechen und uns nicht immer weiter abschotten. Ist die Strategie der Provokation also von Erfolg gekrönt? Für den Moment, sicher, denn die Aufmerksamkeit wird einem gegeben. Der Erfolg, eine größere Zielgruppe anzusprechen, bleibt aus. Sollten sich demokratische Parteien dieser Strategie somit anschließen? Ein sogenanntes „Gegengewicht“ liefern? Fakt ist, die Strategie der Provokation wird längst nicht mehr nur von Populisten verwendet, selbst wenn sie weiterhin den größten Teil ausmachen.
Die Wirtschaftskrisen, der Flüchtlingsnotstand und der Terrorismus innerhalb Europas haben die politische Krise in der EU verschärft und dazu beigetragen, Misstrauen der Bürger gegenüber der Politik zu verstärken. Auf der einen Seite hat dies die Entstehung populistischer Parteien gefördert, die darauf abzielen, den Status quo zu überwinden, was eine Bedrohung für die Demokratie darstellt. Auf der anderen Seite versuchen die demokratischen Parteien und ihre Vorsitzenden, die Lücke zwischen ihnen und den Bürgern wieder zu schließen und neue Kommunikationsstile und -strategien zu entwickeln. Für viele scheint der Schlüssel, um den Menschen näher zu kommen und verlorenes Vertrauen zurück zu gewinnen, die Annahme eines populistischen Kommunikationsstils zu sein.
Viele Wissenschaftler heben bereits die Verbreitung einer Art „Mainstream-Populismus“ hervor[1], an dem sogar die wichtigsten europäischen Parteien beteiligt sind. In diesem Szenario wird Populismus zu einem Stil, einer Sprache, einem Diskurs, der zu den heutigen Medienbedürfnissen passt[2]. Die Vorsitzenden der demokratischen Parteien praktizieren diesen Stil häufig auf Social-Media-Plattformen, die ihnen die Möglichkeit bieten, sich unabhängig von klassischen Medien selbst zu präsentieren. Die Medien werden nicht mehr gebraucht, man muss nur kontrovers genug sein, dass sie von sich aus über einen berichten.
Innerhalb dieser Entwicklung kann eine spezifische Strömung (die sich nicht auf Europa beschränkt) herausgegriffen werden - die „populistische Kontamination“ des politischen Mainstream-Diskurses. Das Problem mit diesem Kommunikationsstil ist, er schürt nicht nur Angst und grenzt aus, sondern homogenisiert auch die Vielfalt der Interessen und Ideen. Eine Demokratie funktioniert jedoch genau dadurch, dass wir stetig verhandeln, im Diskurs sind, unterschiedliche Interessen berücksichtigen und differenzierte Lösungen anbieten, die nicht ohne Widerspruch bleiben müssen. Das Schwarz-Weiß-Denken der Populisten verhindert nicht nur Kompromisse und Konsensfindung, sondern befördert Polarisierung und Spaltung.
Als demokratische Partei sollte man nicht ebenfalls diesem populistischen Kommunikationsstil verfallen, nur weil er auf den ersten Blick erfolgversprechend erscheint. Dieser Erfolg ist nicht von Dauer, denn auf eine Provokation muss eine sachliche Diskussion folgen, das ist jedoch kaum möglich, wenn man sich vorsätzlich vom Tisch des gemeinsamen Diskurses entfernt.
Überdies sind provokative Überspitzungen wie „Steuern sind Raub“ schnell zu widerlegen. Eine sachliche Debatte über unsere wahren Positionen wird dadurch erschwert. Der Shitstorm als Kommunikationsstil bringt uns vielleicht Reichweite auf Twitter, allerdings keine Stimmen.
In der Demokratie wie in der Marktwirtschaft setzt sich langfristig durch, wer Vertrauen schafft. Dieses Vertrauen schafft man nicht durch Spaltung der Gesellschaft, sondern durch die kluge Verknüpfung von Realismus und Vision.
Autorin: Lea von keep it liberal, dort erschienen am 23.08.2020
[1] Mair, P. (2002), Populist Democracy vs Party Democracy; Caiani, M., & Graziano, P. (2016), Varieties of Populism: Insights from the Italian Case.
[2] Jagers, J. & Walgrave, S. (2007), Populism as Political Communication Style; Moffitt, B. & Tormey, S. (2014) Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style.